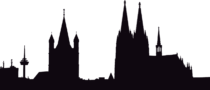Warum ein PMO einführen?
Unternehmen stehen vor zwei gewichtigen Herausforderungen. Auf der einen Seite nimmt die Projektkomplexität zu, auf der anderen Seiten sind Ressourcen knapp. Somit entsteht der Bedarf nach einer strategischen Steuerung und Transparenz. Project-Management-Offices sind hier die Antwort auf ineffizientes Projektmanagement.
Ein PMO wird nicht aus Selbstzweck ins Leben gerufen. Ein PMO bedeutet für das Unternehmen eine Transformation in Strategie und Struktur. Damit ist ein PMO ein wichtiges strategisches Werkzeug im Unternehmen. Mit guten Absichten wird man angesichts der Herausforderungen nicht mehr weit kommen.
Phasen der PMO-Einführung
Phase 1: Analyse und Zieldefinition
In der initialen Phase wird zunächst die aktuelle Projektlandschaft analysiert. Dabei werden Stakeholder befragt und herausgefunden, welche Erwartungen bestehen. Daraufhin kann ein Ziel bzw. können Ziele unter Berücksichtigung von Nutzerargumenten definiert werden. Erst dann können praxisnahe Definitionen erfolgen.
Infolge wird der PMO-Typ festgelegt: direktiv, kontrollierend oder unterstützend.
Phase 2: Design und Strukturierung
Der Aufbau der PMO-Organisation besteht unter anderem darin, Rollen und Verantwortlichkeiten festzulegen. Prozesse werden definiert, Standards und Tools bestimmt. Das PMO wird in die bestehende Unternehmensstruktur integriert.
Phase 3: Rollout und Implementierung
Mittels Pilotprojekte kann eine Validierung erfolgen. Das bedeutet, dass Konzepte und Prozess zunächst in einem kleinen Rahmen getestet und praktische Erfahrung gesammelt werden. Damit wird deutlich, ob die entwickelten Strukturen und Methoden auch wirklich funktionieren und den Bedürfnissen des Unternehmens entgegenkommen. Auf Basis von Pilotprojekten können Verbesserungen vorgenommen werden.
Zur Implementierung eines PMO gehört aber auch die Schulung von Teams und Projektleitern. Außerdem wird der Rahmen für die Kommunikation gesteckt. In der Unternehmenspraxis bedeutet das, dass klare Kommunikationswege und Kommunikationsregeln festgelegt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass der Informationsfluss zum Projekt verständlich, zeitnah und transparent erfolgt.
| Infobox Top 3 Stolpersteine bei der PMO-Einführung Fehlende Akzeptanz Unklare Rollenverteilung Mangelnde Kommunikation |
Phase 4: Monitoring und Optimierung
Dies ist die Phase der Einführung von KPIs und Dashboards zur Beobachtung. Feedbackschleifen werden aufgebaut, um eine kontinuierliche Verbesserung sicherzustellen. Mittels Feedbackschleifen lassen sich Projektfortschritte ermitteln und kurze Retrospektiven festhalten. Teams sprechen offen über Herausforderungen und mit Gelingen erreichte Meilensteine des Projekts. Verbesserungen können damit im laufenden Prozess integriert werden.
Wichtig in dieser Phase: Skalierung und strategische Weiterentwicklung
Ein einfaches Beispiel:
Das PMO wurde erfolgreich eingeführt. Die IT-Abteilung funktioniert mit den neuen Prozessen und Kommunikationswegen gut. Für das PMO kann dies bedeuten, dass das angewandte Konzept auch auf andere Abteilungen ausgedehnt werden kann (Skalierung). Die weiteren Erfahrungen ermöglichen weitere Optimierungen und Anpassungen an die spezifischen Anforderungen der anderen Unternehmensbereiche (strategische Weiterentwicklung).
| Eventübersicht Zeitstrahl zur PMO-Einführung |
| Monat 1–2: Analyse und Zieldefinition |
| Monat 3–4: Design und Struktur |
| Monat 5–6: Rollout und Schulung |
| Ab Monat 7: Monitoring und Optimierung |
Typische Stolpersteine
Unklare Zielsetzung: bedeutet, dass das PMO ohne strategische Ausrichtung agiert.
Widerstand im Unternehmen: Die Wahrnehmung „Bürokratie statt Hilfe“ könnte in den Köpfen aufkommen.
Fehlende Ressourcen: das PMO wird nur nebenbei betrieben.
Tool-Fokus statt Kulturwandel: Kommunikation kann durch keine Technik ersetzt werden.
Zu schnelle Skalierung: hat zu Folge, dass das PMO sich selbst überfordert.
Best Practices für eine erfolgreiche Einführung
Stakeholder sollten früh eingebunden werden. Damit kommt mehr Transparenz und Mitgestaltung ins Spiel, was der Akzeptant förderlich ist.
Pilotprojekte sind zunächst das Lernfeld. In der Praxis bedeutet das, zunächst klein zu starten und groß zu denken.
Eine Schlüsselfunktion stellt die Kommunikation dar. Der Nutzen muss klar und deutlich kommuniziert werden, und zwar regelmäßig.
Kleine Erfolge zu dokumentieren und zu teilen, macht für alle Beteiligten die Erfolge sichtbar.
PMOs, die die Flexibilität wahren, hinterfragen von Zeit zu Zeit ihre Struktur und passen sich an.
Weitere Infos auch auf: https://de.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Office
Was nehmen wir über die Einführung von PMOs mit?
Die Einführung eines PMO (Projekt Management Büro) ist ein strategischer Wandel im Unternehmen und kein IT-Projekt. Erfolge sind wesentlich davon abhängig, wie klar Ziele definiert werden, welche Kommunikationskultur vorherrscht und wie flexibel das PMO in Bezug auf Anpassung ist.
Agile PMOs nehmen an Bedeutung zu, auch hybride Modelle sind denkbar. KI könnte bei der Steuerung an Einfluss gewinnen.
PMOs machen Innovation und Transformation für Unternehmen möglich.
FAQ zur PMO-Einführung
Wie lange dauert die Einführung eines PMO?
Der Zeitraum für die Etablierung eines Projekt Management Büros hängt stark von der Unternehmensgröße ab und spielt sich in Zeiträumen zwischen 6 und 12 Monaten ab, wozu auch eine Pilotphase gehört.
Braucht jedes Unternehmen ein PMO?
Nicht jedes Unternehmen brauch ein PMO. Sinnvoll werden PMOs bei einer gewissen Anzahl an Projekten oder strategischen Relevanz.
Wie überzeuge ich das Management von einem PMO?
Nutzerargumente, ROI-Berechnungen und Praxisbeispiele sind schlagkräftige Argumente für ein PMO.
Was ist der Unterschied zwischen einem PMO und einem Projektcontroller?
Das PMO ist auf Strategie und Struktur fokussiert, der Controller auf Zahlen und Berichte.
(Bildquelle: Pixabay.com – CC0 Public Domain)